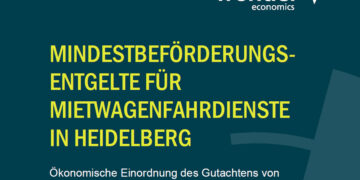Verstöße gegen Rückkehrpflicht und weitere PBefG-Regeln reichen nicht ohne Weiteres für einen Konzessionsentzug aus. Kommt ein fehlender Versicherungsschutz der Fahrzeuge dazu, so sieht es anders aus.
Auch wenn diverse Verstöße gegen Rückkehrpflicht oder andere PBefG-Pflichten nachweisbar sind, bedarf es einer gerichtlichen Überprüfung, bevor Konzessionen mangels persönlicher Zuverlässigkeit entzogen werden dürfen. Anders sieht es allerdings aus, wenn kein ausreichender Versicherungsschutz der eingesetzten Fahrzeuge vorliegt, dann kann auch ein sofortiger Vollzug des Konzessionswiderrufs gerechtfertigt sein.
Die zuständige Genehmigungsbehörde hatte im Dezember vergangenen Jahres die einem für Uber tätigen Stuttgarter Mehrwagenunternehmen erteilten Mietwagengenehmigungen mit sofortigem Vollzug widerrufen. Gegen diesen sofortigen Vollzug hatte das Unternehmen Widerspruch eingelegt und bekam dafür nun Ende Mai vor dem Stuttgarter Verwaltungsgericht Recht (VG Stuttgart, AZ 8 K 7692/23 vom 23.05.2024). Solch eine Vollziehungsanordnung setze Gefahren für Leib und Leben der Fahrgäste voraus, beispielsweise durch einen fehlenden Versicherungsschutz. Nur dann sei eine solche Maßnahme auch im Eilverfahren gerechtfertigt. Auch angenommene Sozialversicherungsrechtsverstöße waren hier bisher nicht ausreichend oder nicht ausreichend belegt; dies blieb offen.
Das private Interesse des Unternehmens überwiege hier noch das öffentliche Interesse am Sofortvollzug, da die – auch aus Sicht des Gerichtes mehr als nachvollziehbaren – Zweifel an der persönlichen Zuverlässigkeit bisher noch nicht im parallel anhängigen Widerspruchsverfahren endgültig beschieden worden seien. Allerdings setzte sich das Verwaltungsgericht inhaltlich dann so detailliert mit den – hier auch nach Ansicht des Gerichtes doch schon mehr oder weniger zweifelsfrei belegten – Verstößen gegen die Auftragseingangspflicht am Betriebssitz oder auch gegen die Rückkehrpflicht auseinander, dass es den Inhalt der noch ausstehenden Widerspruchsentscheidung quasi vorweg genommen hat. Demnach darf das strittige Unternehmen dann kaum noch mit einem Erfolg rechnen. Auch bestätigte das Gericht der Behörde ausdrücklich, „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ formell und inhaltlich korrekt gehandelt zu haben, womit es der zukünftigen Anmahnung vermeintlicher Formfehler ebenfalls konsequent entgegen getreten ist.
Das Gericht stellt auch fest, dass die einzelnen Zweifel an der persönlichen Zuverlässigkeit nicht zwangsläufig allein geeignet sein müssen, diese vollständig in Frage zu stellen. Vielmehr reiche es aus, wenn sie „in der Summe ihrer Häufigkeit bei der an der Gesamtpersönlichkeit des Antragstellers auszurichtenden Prognose … einen schwerwiegenden Hang zur Nichtbeachtung gesetzlicher Vorschriften erkennen lasse(n)“. Auch sei es nicht notwendig, dass ein schwerer Verstoß auch zu einer Verurteilung geführt hat; hier reiche schon der Nachweis ansich aus.
Auch den Versuch des Unternehmens, dem Gericht die Nutzung der Uber-Fleet-App-Daten zu untersagen, schmetterte das Gericht ab. Es stellte fest, dass die im Rahmen einer so genannten „Betriebssitzprüfung“ ausgehändigten Mindestlohn- und Fahrtaufzeichnungen auf der Uber-Fleet-App auch von dem Gericht ausgewertet werden dürften. Die Fleet-App-Daten hatte das Unternehmen hilfsweise per E-Mail an die Behörde weitergeleitet, da es selber bei der Prüfung vor Ort keine Daten vorweisen konnte. Der Zugriff auf solche Daten durch die prüfende Behörde sei durch das gemäß Paragraf 54 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) zugestandene pflichtgemäße Ermessen gedeckt. Dies beziehe sich auch auf digital verfügbare Daten, vor allem, wenn das Unternehmen selbst keine Auftragseingangsdaten vorlegen kann.
Bei der Rückkehrpflicht ließ es sich das Gericht ebenfalls nicht nehmen, Intention und Verfahrensweise genauestens zu betrachten, um dann festzustellen, dass das Unternehmen vorsätzlich dagegen verstoßen habe. Auch diskutierte es das Thema Pausen auf der Rückfahrt und legte detailliert fest, was es dabei als legitim erachte und was nicht. Es hält dann fest: „Eine Rückkehr zum Betriebssitz findet … mit den Mietwagen … in der Regel nicht statt, vielmehr ist von einer systematischen Nichtbeachtung dieser Pflicht auszugehen.“
Ebenfalls durchdrang das Gericht die Praxis der systematischen Umgehung der Auftragseingangsverpflichtung am Betriebssitz eines Mietwagenunternehmens durch die hier klagenden Antragsteller – und lieferte damit auch anderen Gerichten oder Behörden eine Blaupause zur Erklärung dieser Praxis. Fast genüsslich nahm es die Versuche der Antragsteller, im Nachhinein doch noch eine personell besetzte Zentrale zu fingieren, auseinander und interpretierte diese Versuche „als reine Schutzbehauptung“. So erscheine es bei den von den Antragsstellern geschilderten Problemen bei der Zentralenbesetzung tagsüber auch völlig fernliegend, dass dann nachts alles anders laufe. Es stellte außerdem fest, dass gerade, weil die Rückkehrpflicht behördlich so schlecht zu überwachen sei, die Vertrauenswürdigkeit eines Unternehmers von besonderer Bedeutung sei. Bei der systematischen Nichtbeachtung der Rückkehrpflicht im Unternehmen sei daher beispielsweise auch eine vorherige schriftliche Mahnung nicht erforderlich gewesen.
Zu guter Letzt stellte das Gericht klar, dass es sozialversicherungs- und steuerrechtlich auch ein Zweck der diesbezüglichen Regelungen sei, Unternehmer auszuschließen, die dadurch ihren Betrieb auf Kosten anderer förderten, indem sie sich diesen Verpflichtungen entzögen. Sie würden so reellen Unternehmen mittelbar einen unbilligen Wettbewerb bereiten – ein Hinweis, der nicht nur Mietwagenunternehmer aufhorchen lassen sollte. Ein von der Behörde beauftragtes Kurzgutachten vom Büro Linne+Krause weise auf schwere Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Pflichten hin, in der summarischen Prüfung fehle es aber „(noch)“ an einer hinreichenden Tatsachengrundlage.
Eigentlich also ein klassischer Pyrrhussieg für das Unternehmen, denn dadurch, dass es das Gericht zu einer so differenzierten Auseinandersetzung mit dem Thema gezwungen hat, hat es das Gericht gleichzeitig dazu genötigt, sich intensiv mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen, die zum angestrebten Konzessionsentzug geführt hatten. „Noch einen solchen Sieg über die Römer, dann sind wir vollständig verloren“, soll der klassische König Pyrrhos I. von Epirus nach seinen Erfolgen über die Römer ausgerufen haben. Auch das Gericht ließ es sich nicht nehmen, sich prinzipiell zum Thema auszulassen – und ließ dabei kaum ein gutes Haar an dem klagenden Unternehmen und seiner Betriebspraxis.
Problematisch ist an dieser rechtsstaatlich sicherlich hochkorrekten Verfahrensweise allerdings, dass die für einen Konzessionsentzug notwendigen Zweifel an der persönlichen Zuverlässigkeit rechtlich immer personenbezogen zu interpretieren sind. Übernimmt nun während eines anhängigen Konzessionsentzugsverfahrens ein neuer erfolgreicher Absolvent der Sach- und Fachkundeprüfung den Betrieb oder wird dort als Geschäftsführer etabliert, dann stehen die Signale zunächst wieder auf Grün für diesen neuen Geschäftsführer oder Inhaber. Im Ergebnis werden die Gerichte ohne Eilentscheidungen so also einfach zu langsam sein, um dem dadurch möglichen Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel der Konzessionäre Paroli bieten zu können. Hier schlägt Pyrrhus dann doppelt zu und hinterlässt auch bei der Gegenpartei den faden Geschmack der Niederlage, obwohl sich die Ausführungen des Gerichtes aus Mitbewerbersicht zunächst recht herzerfrischend lasen.
Als Strohhalm verbleibt zunächst nur der mögliche Nachweis der nicht sachgerechten Kfz-Haftpflicht-Versicherung der Fahrzeuge, da das Verwaltungsgericht dies als einzigen Grund für einen Sofortvollzug anerkannt hat. In dieser Logik könnten vielleicht aber auch nachweisliche Arbeitszeitverstöße die gleiche Funktion erfüllen, weil dadurch möglicherweise die Gesundheit des Fahrpersonals und auch die Sicherheit ihrer Fahrgäste gefährdet sein könnte. rw
Beitragsbild: Die Elefanten des Pyrrhus, um 1900, Künstler unbekannt