Mindestbeförderungsentgelte gelten als eine der wenigen Optionen, den Preiskampf zwischen Taxi und App-basierten Mietwagen auf ein legal-verträgliches Niveau zu heben. Wie dies genau aussehen kann, hat nun ein Gutachten im Auftrag der Stadt Heidelberg formuliert – und dazu auch das Geschäftsmodell der Plattformer analysiert.
Neben den Brennpunkten in Berlin, München, Frankfurt am Main oder dem Westen der Republik sind App-basierte Mietwagen auch im Großraum Heidelberg sehr aktiv. Überall dort aber, wo jene Mietwagen am Markt auftauchen, drohen ruinöse Preiskämpfe zwischen Taxi und diesen Anbietern und gefährden die Existenz einer 24/7-Grundversorgung im Gelegenheitsverkehr vor Ort, da sich das Gewerbe, wenn überhaupt, dann nur noch zu Spitzenzeiten im Tagesverlauf lohnt. Der Gesetzgeber sieht sich daher durchaus in der Verantwortung, diesen Wettbewerb zu reglementieren, ohne aber parallel die Gewerbefreiheit zu unterminieren.
Die Option ein Mindestbeförderungsentgelt (MBE) einzuführen, war mit der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) im Jahr 2021 vom Gesetzgeber etabliert worden. Sie soll, gemeinsam mit der ebenfalls neuen Möglichkeit, tarifbasierte Festpreise für Bestellfahrten mit Taxis über einen Tarifkorridor anzubieten, den vielfach entstehenden Preiskampf zwischen Taxi und Mietwagen auf eine rechtlich solide Basis stellen und so einen ruinösen Wettbewerb und mögliches Sozialdumping zu Lasten der Beschäftigten verhindern.
Die entsprechenden Instrumente sind also noch relativ neu und beinhalten einen Drahtseilakt zwischen der Akzeptanz der grundgesetzlich garantierten Gewerbefreiheit und der danach ebenfalls auferlegten Daseinsvorsorge, welchen sich der Staat verpflichtet sieht. Die Stadt Heidelberg hat daher entschieden, sich professionell mit den Folgen des bestehenden Preiskampfes im Gelegenheitsverkehr auseinander zu setzen und ein Gutachten über die mögliche Ausgestaltung eines Mindestbeförderungsentgeltes für Mietwagen in Auftrag gegeben.
Dieses Gutachten hat Linne & Krause aus Hamburg nunmehr erstellt. Es wurde von der Stadt Heidelberg neben einem parallel erstellten Taxitarifgutachten inzwischen auch veröffentlicht – ein Funktionsfähigkeitsgutachten steht nach Taxi Times Informationen kurz vor der Fertigstellung. Da dieses MBE-Gutachten wohl das erste seiner Art in Deutschland ist, lohnt es sich für die Unternehmen und Behörden aller Städte und Regionen, die sich ebenfalls von appbasierten Mietwagen bedroht oder schon überrollt sehen, einen genauen Blick auf die Ergebnisse dieses Gutachtens zu werfen.
Konkrete Aufgabenstellung sei es, der Stadt Heidelberg eine „nachvollziehbare Tatsachenbasis dafür, dass ohne Tätigwerden mit einiger Sicherheit eine Beeinträchtigung von öffentlichen Verkehrsinteressen eintreten würde“ zu liefern und zugleich einen Vorschlag zur künftigen Gestaltung des MBE zu erarbeiten, formuliert das Gutachten seine Aufgabe.
Methodisch analysiert das Gutachten zunächst die offensichtliche Kalkulation der Uber-Fahrpreise, da der amerikanische Riese auch im Südwesten der Republik den Großteil der dort aktiven appbasierten Mietwagen stellt. Dazu wurde die betriebswirtschaftliche Kalkulation des Uber-Ankerbetriebs untersucht, der vor Ort den größten Teil der Mietwagen betreibt. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie der erhebliche preisliche Abstand zum Taxitarif trotz weitestgehend identischer Leistungserbringung und annährend gleicher Kosten realisiert werden kann. Dabei zeigt sich, dass die günstigen Verbraucherpreise nur durch ein komplexes System aus Abzügen und „Marketingleistungen“ genannten Zuschüssen des Plattformbetreibers möglich werden, ergaben die Erhebungen der Hamburger.
Bei einem genauen Blick stellt das Gutachten fest, dass das aktuell praktizierte Geschäftsmodell „appvermittelte Mietwagen“ auf Ebene der Subunternehmer eigenwirtschaftlich definitiv nicht tragfähig sei. Das Gutachten stellt fest, dass jeder Euro, der dort eingenommen wird, noch einmal mit 50 Cent durch die Plattform subventioniert wird. „Die Unternehmen sind auf Anreize und Unterstützungsleistungen angewiesen, um ihre Kosten halbwegs decken zu können. Nur mit ihnen werde das Mietwagengeschäft erhalten, denn es könne eigenwirtschaftlich nicht existieren“ zitiert das Gutachten auch Alexander Mönch, den CEO der konkurrierenden Plattform Free Now.
Der Gesetzgeber aber strebe ein Level-Playing-Field zwischen den zulässigen Verkehrsformen an. Schutzzweck des MBE sei das „öffentliche Verkehrsinteresse“. Dabei sei von besonderer Bedeutung, welche Auswirkung der appvermittelte Mietwagenverkehr auf wettbewerbsrelevante Verkehrsformen habe, schreibt das Gutachten: „Eine Gefährdung des lokalen öffentlichen Verkehrssystems sei bereits dann zu bejahen, wenn durch tariflich unreglementierte Mietwagen eine Schädigung auch nur eines seiner tragenden Pfeiler droht, wovon insbesondere der Taxiverkehr betroffen sein kann.“
Das Taxigewerbe sei zwar nicht per se schützenswert, erarbeitet das Gutachten weiter: „§ 49 Abs. 4 PBefG schützt (…) zwar nicht den einzelnen Taxiunternehmer vor Konkurrenz. Aber er schützt die Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxigewerbes als Gesamtheit“. Das Taxigewerbe sei Teil der Daseinsvorsorge und nehme eine nicht zu ersetzende Ergänzungsfunktion zum ÖPNV wahr. Dieser Funktion verdanke es seinen Status als schützenswertes „überragend wichtiges Gemeinschaftsgut“. Es bestehe somit ein öffentliches Verkehrsinteresse an einer ordnungsgemäßen und verlässlichen Taxiversorgung – besonders an einem international bedeutenden Tourismus- und Gesundheitsstandort wie Heidelberg.
Natürlich verweist auch das vorliegende Gutachten in der Folge auf das aktuelle Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig (VG), nach dem das PBefG insgesamt darauf abziele, einen sicheren Transport zu gewährleisten, eine 24-Stunden-Versorgung sicherzustellen, feste Tarife zu garantieren und Mindeststandards bei den Fahrern zu erhalten, womit es der Sicherheit der Bürger diene. Das VG Leipzig hatte kürzlich sogar die präventive Einführung von MBEs eingefordert, schon bevor ruinöse Preiskämpfe realisiert würden.
Zumindest für den innerstädtischen Bereich böten appvermittelte Mietwagen und Taxis eine Dienstleistung, die sich aus Verbrauchersicht abgesehen vom Preis nicht unterscheide. Gleichzeitig unterscheiden sich auch die Betriebswirtschaften beider Verkehrsformen nur marginal. Das Gutachten stellt dazu fest, dass die weitgehende Gleichartigkeit der Leistung zum Verdrängungswettbewerb zwischen appvermittelten Mietwagen und Taxis führen würde, den letztere wegen ihrer Tarifbindung und der fehlenden Alimentierung nicht für sich entscheiden könnten. Würde die Alimentierung allerdings heruntergefahren oder entfalle gänzlich, stünden die Subunternehmer der Plattformen vor der Wahl, den Betrieb einzustellen oder ihn irregulär weiterzuführen. Prüfungen in anderen Städten zeigten, dass solche Betriebe ohne außerordentliche Alimentierung in erheblichem Maße Löhne und Steuern vorenthielten. Die örtlichen Taxientgelte seien dagegen betriebswirtschaftlich orientiert. Sie seien nach den Erhebungen des Gutachtens wirtschaftlich und beinhalteten einen angemessenen Gewinn.
In der Zusammenfassung kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass innerstädtische Uber-Fahrten brutto rund 38 Prozent günstiger als Fahrten mit dem Taxi seien. Diese günstigen Fahrpreise resultierten jedoch nur minimal auf einer besseren Auslastung der Mietwagen gegenüber den Taxis. Ausschlaggebend sei vielmehr eine massive Alimentierung des Subunternehmens durch die Plattform. Die Auswertung der Abrechnungen zwischen Subunternehmer und Plattform zeige, dass die Plattform auf jeden Euro, den der Fahrgast entrichte, die Plattform noch einmal rund 50 Cent hinzuschieße. Ohne diese massive Alimentierung durch die Plattform sei das aktuelle Geschäftsmodell für den Subunternehmer aber nicht legal zu betreiben. Der erhebliche Preisunterschied sei somit nur zum geringen Teil auf betriebswirtschaftliche Vorteile zurückzuführen.
Auf dieser Basis empfiehlt das Gutachten, für die Stadt Heidelberg auch in Anlehnung an das Leipziger Urteil ein MBE per Allgemeinverfügung festzulegen, welches gewährleiste, dass ein preislicher Abstand von rund 7,5 Prozent zum Taxitarif nicht unterschritten werde. Damit sei zugleich hinreichend Spielraum für eine preisliche Differenzierung zwischen beiden Verkehrsformen gegeben, der es erlaube, die von UBER immer wieder hervorgehobenen Kostenvorteile durch bessere Auslastung, bessere Organisation oder günstigere Versicherungskonditionen zum Tragen zu bringen.
Das Heidelberger Gutachten hat damit den Plattformbetreibern insofern ökonomisch Nachhilfe gegeben, dass deren Geschäftsmodell betriebswirtschaftlich lediglich mit minimal ca. 35 prozentiger Subvention betrieben werden kann. Die seitens dieser Anbieter vielfach in den Raum gestellte bessere Auslastung macht hier nur einen minimalen Bruchteil des Unterschiedes aus. Nun kommt es wohl darauf an, diese Ergebnisse auch publik zu machen, um die MBEs auch bundesweit endlich auf die Erfolgsspur zu bringen.
Das MBE-Gutachten für Heidelberg kann hier nachgelesen werden. Parallel finden Interessierte das Taxi-Tarifgutachten für Heidelberg hier. rw
Beitragsfoto: Remmer Witte




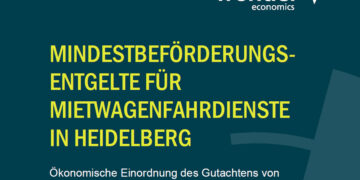



Auch wenn die Kostendeckung vorn und hinten nicht funktioniert … Mich erstaunt etwas die Behauptung, dass Uber dem Mietwagenunternehmer direkte wirtschaftliche „Alimentierung“ leisten soll. Wurden dafür etwa konkrete Zahlungseingänge vorgelegt?
Zitat aus dem Artikel: „Dabei zeigt sich, dass die günstigen Verbraucherpreise nur durch ein komplexes System aus Abzügen und „Marketingleistungen“ genannten Zuschüssen des Plattformbetreibers möglich werden, ergaben die Erhebungen der Hamburger.“
Dass das UBER-Business nur durch Preissubvention von Seiten UBERs funktioniert, ist doch wohl völlig evident.
Brauchen Sie nicht zu belegen, das siehst du an den Zahlen, die Uber selbst veröffentlicht.
Christoph Weigler der Uber Deutschland Sprechen behauptet man wolle die Mindestpreise nicht weil man angeblich an die Menschen mit niedrigem Einkommen denkt die sich eventuell einen Mietwagen nicht leisten würden können. Eine Frage lieber Herr und ich bin mir sicher du liest das hier permanent.
Wie sollen die denn Menschen mit niedrigem Einkommen sich eine Fahrt zur Apotheke leisten können wenn z. B. der Fahrpreis auf Grund vom Fußball Spiel , Messe , Regen , Schnee ect durch dynamischen Preis sechs mal so teuer wird ? Soll der Mensch der grade dringen sein Medikament braucht auf die Fahrt verzichten oder habt ihr einen gesonderten Vorschlag für diese unangenehme oder vielleicht für das Menschen Leben gefährliche Situation?
Ich bitte alle Uber Helden um ein Antwort.
Danke
Wie groß ist denn eigentlich „die vielfach in den Raum gestellte bessere Auslastung“??? Ich seh häufig nur
herumschwarodierende oder herumlungernde UBERS (sogar auch auf unseren Taxiständen), statt daß diese SOFORT nach jeden Auftrag heim zu Ihrer Firma fahren (FFB, FS, WOR, DAH, ………..). Am unangenehmsten sind mir aber inzwischen unsere eigenen UBER-TAXLER.
Danke für diesen Tollen Bericht.