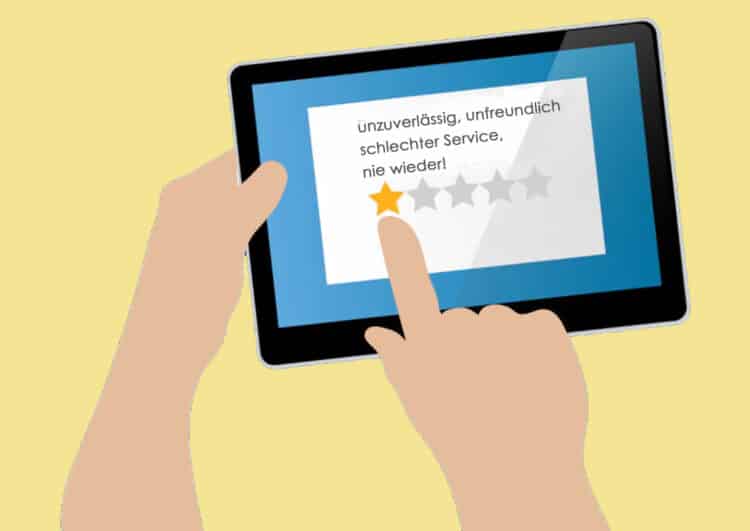Negative Bewertungen im Internet schaden allen Firmen, auch Taxi- und Mietwagenunternehmen. Aus diesem Grund stellt sich betroffenen Unternehmen auch die Frage, ob und wie man ungerechtfertigte Bewertungen wieder aus dem Netz entfernen lassen kann – und welche arbeitsvertraglichen Maßnahmen präventiv wirken.
Natürlich gibt es Unternehmen, die sich ihren schlechten Kommentar redlich verdient haben. In vielen Fällen aber entspringt so ein Negativ-Kommentar eher einem momentanen Frust und hat mit den tatsächlichen Leistungen wenig zu tun. Es sind nur wenige Klicks, und schon hat man einem missliebigen Mitbewerber oder auch dem ehemaligen Arbeitgeber, über den man sich gerade geärgert hat, eins ausgewischt. Ist der Ärger wieder verflogen, vergessen viele Autoren ihren Kommentar zwar schnell wieder, das Internet aber vergisst bekanntlich nichts und die Bewertung bleibt auf ewig bestehen.
Will man sich gegen solche ungerechtfertigten Beurteilungen wehren, steht man vor einem Riesenproblem: Zum einen ist die Unterscheidung zwischen gerechtfertigten und ungerechtfertigten Kommentaren für Außenstehende kaum möglich und zum anderen fühlen sich Google & Co. in der Regel auch gar nicht erst nicht für die Kommentare ihrer Kunden verantwortlich.
Bewertungsportale bieten teilweise die Möglichkeit, auf Bewertungen zu reagieren. Die Nutzung dieser Reaktionsmöglichkeit sollte jedoch gut überlegt sein. Als Betroffener sollte man keinesfalls persönlich werden und öffentlich emotional reagieren. Zudem sollte man keine Rechtfertigungen abgeben. Wenn überhaupt, sollte ein sachlicher, kurzer Kommentar verfasst werden, der ggf. eine falsche Bewertung widerlegt oder die Aussage enthält, dass man sich die berechtigte Kritik zu Herzen nimmt.
Eine andere – allerdings aufwändige – Option ist, sich gerade bei ungerechtfertigten Negativbewertungen eine klassische Schwäche solcher Bewertungen zu Nutze machen: deren Anonymität.
Dazu muss man sich zunächst die rechtlichen Vorgaben ansehen: Gibt jemand eine negative Bewertung ab, die nicht gegen die Richtlinien des Portalbetreibers oder geltendes Recht verstößt, sind diese grundsätzlich zulässig und unterliegen der Meinungsfreiheit. Trotzdem kann das auch im Einzelfall auch anders bewertet werden, wie eine Entscheidung des Landgerichts Mainz (LG Mainz, Urteil v. 09.05.2022 – AZ 1 O 86/17) beweist. Im vorliegenden Fall hatten zwei Bewertende unter Abgabe einer negativen 1-Sterne-Google Bewertung von der Inanspruchnahme eines Unternehmens abgeraten. Diese beiden pauschalen Aussagen hat das Landgericht Mainz zwar als zulässige Meinungsäußerung gewertet, da diese Kommentare weder gegen die Google-Richtlinien noch geltendes Recht verstießen. Das Gericht hatte Google aber dennoch zur Löschung der beiden negativen Bewertungen verurteilt, da beide Autoren Fake-Namen verwendet hatten. Auf diesem Umweg lässt sich also möglicherweise ein Löschungsanspruch realisieren.
Das Landgericht Mainz verdeutlichte, dass negative Bewertungen selbst dann gelöscht werden müssten, wenn diese grundsätzlich von der Meinungs- und Medienfreiheit geschützt seien. In solchen Fällen müsse eine Rechtsabwägung vorgenommen werden. Im konkreten Fall verletzten die beiden negativen Bewertungen das Unternehmerpersönlichkeitsrecht des Klägers und waren geeignet, das öffentliche Bild des Unternehmens zu schaden. Der Kläger hatte das Gericht darauf hingewiesen, dass die beiden Bewertungen offensichtlich von Nichtkunden stammen und deshalb der faktischen Grundlage entbehrten.
Vor dem Hintergrund, dass die beiden Bewertungen unter einem Fake-Namen abgegeben worden waren, konnte nicht überprüft werden, ob es sich tatsächlich um Kunden gehandelt hat. Der Kläger war ohne Mitwirkung der Autoren der Negativkommentare aber nicht in der Lage, konkrete Darlegungen zu den beiden Bewertungen abzugeben. Ihm blieb so gar nichts anderes übrig, als den Kundenkontakt zu bestreiten. Ein Rechtsverstoß war aus Sicht des Gerichtes daher trotz der grundsätzlich schützenswerten freien Meinungsäußerung zu bejahen.
Internetportale haften nach dem BGB als mittelbare Störerin für rechtswidrige negative Bewertungen. Jedoch sind sie nicht verpflichtet, die von Nutzern eingestellten und veröffentlichten Bewertungen auf Rechtsverletzungen zu überprüfen. Weist jedoch ein Betroffener die Providerbetreiber auf die Rechtsverletzung hin, sind diese verpflichtet, das Prüfverfahren für die beanstandete negative Bewertung nach dem sogenannten „Notice-and-take-down“ Prinzip einzuleiten.
In der Praxis leitet beispielsweise Google die Beanstandung an den Bewerter per E-Mail weiter und bittet um Stellungnahme. Erfolgt keine Stellungnahme, wird die Bewertung gelöscht. Allerdings neigt gerade auch Google wohl dazu, Beschwerden von betroffenen Unternehmen nicht oder nur sehr zögerlich zu bearbeiten. Daher wird man dafür wohl kaum um die Unterstützung durch einen juristischen Bestand herumkommen, wenn man einen Negativ-Kommentar eines anonymen Autoren aus dem Netz entfernen lassen möchte.
Ist hingegen bekannt, wer den Kommentar verfasst hat, kommt ein Beseitigungsanspruch in Betracht. Dieser kann im ersten Schritt durch Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung durchgesetzt werden. Der Anspruch wird jedoch nur dann anerkannt, wenn die Bewertung nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt und rechtswidrig ist. Dieser Fall tritt besonders häufig im Rahmen von Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf. Ist der Autor der negativen Bewertung in dieser Konstellation noch beim Arbeitgeber beschäftigt, entsteht auf Seiten des Arbeitgebers vielfach der Wunsch, sich von dem Arbeiternehmer zu trennen. Aber auch eine verhaltensbedingte Kündigung wird regelmäßig nur wirksam sein, wenn die Äußerung den Schutzbereich der Meinungsfreiheit verlässt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Interessen des Arbeitgebers gegenüber den Belangen des negativ kommentierenden Arbeitnehmers überwiegen.
Sinnvoll erscheint im Übrigen auch ein arbeitsvertraglicher Hinweis, um das Entstehen negativer Bewertungen zu unterbinden. Allerdings dürfen Arbeitgeber das Recht auf freie Meinungsäußerung ihrer Arbeitnehmer nicht einschränken. So ist sachliche Kritik am Unternehmen oder am Arbeitgeber als Teil der Meinungsfreiheit vom Grundgesetz nach Art. 5 Abs. 1 GG geschützt und vom Arbeitgeber hinzunehmen. Nicht erlaubt sind jedoch unwahre Tatsachenbehauptungen, Formalbeleidigungen oder Kritik, welche die Grenze zur Schmähkritik überschreitet. Denkbar ist deshalb eine Klausel, die den Arbeitnehmer zu gemäßigten Äußerungen und Loyalität anhält. Unabhängig von ihrer Wirksamkeit im Einzelfall stellt eine solche Klausel somit eine zusätzliche Hemmschwelle für den Arbeitnehmer dar.
Eine wichtige Rolle kann auch die typischerweise im Arbeitsvertrag enthaltene Verschwiegenheitsklausel spielen, denn sie untersagt, dass Betriebsinterna nach außen bzw. in die grenzenlose Welt des Internets getragen werden. Und spätestens, wenn die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch Aufhebungsvertrag oder gerichtlichen Vergleich angestrebt wird, sollte nach Möglichkeit eine zu gemäßigten Äußerungen anhaltende Klausel aufgenommen werden, um reagieren zu können, wenn sich nachträglicher Frust im Netz entlädt. rw
Beitragsfoto: Graphik: Remmer Witte